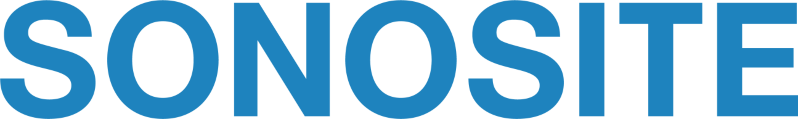ÜBER UNS
Haiti
Sachita Shah, MD, Notärztin
in Haiti nach dem Erdbeben von 2010
Tag 1 – Ankunft in Haiti, 27. Januar 2010
Als wir am 16. Januar in der Hauptstadt Port-au-Prince ankamen, waren die Spuren der Zerstörung allgegenwärtig. Besonders betroffen war die Stadt Carrefour mit ihren zerstörten Häusern, die wir schon vom Flugzeug aus sehen konnten. Der Flughafen war Militärzone, und das UN-Gebiet stark beschädigt. Überall durchsuchten bewaffnete UN- und US-Soldaten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen die Trümmer. Wir wurden mit Fahrzeugen der Hilfsorganisation Zanmi Lasante an verschiedene mögliche Sammelpunkte gefahren, deren Infrastruktur jedoch weitgehend zerstört war. Letztlich quartierten wir uns in einem Büro ein und teilten uns in zwei Teams auf: Saint Marc und Cange. Es konnte losgehen.
Die Straßen waren voller Menschen, wir sahen eingefallene Häuser und lange Autoschlangen vor den wenigen Tankstellen, die noch Benzin verkauften. Als wir das Saint Marc Hospital erreichten, fanden wir ein verlassenes Gebäude vor – die Menschen waren auf der Suche nach ihren Familien unterwegs nach Port-au-Prince.
Das Krankenhaus – Ordnung im Chaos
Die ersten Tage im Krankenhaus waren schwierig und schockierend. Wir fanden einen schmutzigen, nicht einsatzfähigen OP-Saal vor, und auf den Fußböden der einzelnen Stationen lagen etwa 200 Patienten, von denen 40 aufgrund ihrer offenen Brüche und eiternden Wunden dringend operiert werden mussten. Fliegen schwirrten über den infizierten Wunden der Patienten, die von weinenden Familienangehörigen umgeben waren. Die Patienten waren am Ende ihrer Kräfte, viele litten an tödlichen Blutvergiftungen, und ihr Urin hatte sich infolge von Rhabdomyolysen schwarz verfärbt. An den ersten beiden Tagen versuchten wir, eine gewisse Ordnung in das Chaos zu bringen, trotz der Probleme mit Sicherheitskräften und wütenden Menschenmengen, dem Wasser- und Nahrungsmangel, fehlenden haitianischen Ärzten und Pflegekräften und der mangelnden Verbindung zur Außenwelt (kein Telefon, kein Internet). Wir reinigten den OP und richteten ihn ein, funktionierten einen Lagerraum zum Aufwachraum um, säuberten und bauten Liegen und identifizierten, untersuchten und trösteten Patienten. Es wurde ein Triagesystem eingeführt: Zuerst führten wir lebensrettende Maßnahmen durch, dann kümmerten wir uns um Extremitäten, danach um stabile Frakturen und nicht lebensgefährliche Wunden, und schließlich um die Nachbehandlung. Patienten mit Wirbelsäulenverletzungen und Beckenbrüchen mussten ausgeflogen werden, also setzten wir uns per SMS mit der US-Marine in Verbindung, die diese Patienten mit einem Hubschrauber von einem nahegelegenen Fußballplatz abholte. Es schien zu funktionieren.
Doch jeden Tag stießen wir trotz aller Bemühungen auf unerwartete Hindernisse und Rückschläge.
So gab es zum Beispiel wenige Tage nach unserer Ankunft ein Nachbeben, das unser Quartier erschütterte. Wir liefen nach draußen und machten uns auf dem Weg zum Krankenhaus. Der OP war beschädigt worden, und einige Patienten hatten neue Verletzungen erlitten, weil sie aus Angst davor, verschüttet zu werden, aus Fenstern und von Dächern gesprungen waren.
Nach zwei Wochen – „Gen la vie la dan“
„Gen la vie la dan“ ist ein Ausdruck aus der haitianischen Kreolsprache und bedeutet so viel wie „das Leben ist aus ihm gewichen“ (in Bezug auf Extremitäten). Dieser Ausruf schwirrte in den letzten zwei Wochen nur allzu oft durch die Stationen des Saint Marc Hospital. Bei unserem Versuch, die notwendigsten Amputationen zuerst anzugehen, mussten wir erfahren, dass viele Haitianer lieber sterben als sich amputieren zu lassen, weil Körperbehinderte hier nur unter äußerst widrigen Umständen leben können. Viele unserer Patienten lehnten Amputationen trotz der Lebensgefahr durch Infektionen ab oder verließen das Krankenhaus, um eine zweite Meinung einzuholen. Andere fanden sich damit ab, dass sie ihre gefühllosen Extremitäten verlieren würden. Die sechzehnjährige Ania wurde mit einem lebensgefährlich gequetschten Bein eingeliefert, das oberhalb des Knies amputiert werden musste. Als wir bei einem Verbandswechsel mit ihr ins Gespräch kamen, erzählte sie uns unter Tränen, dass ihrer Mutter in einem Krankenhaus in Port-au-Prince beide Beine amputiert worden waren. Sie übte unermüdlich den Umgang mit Rollstuhl und Krücken, damit sie ihre Mutter in Port-au-Prince suchen konnte.
Am siebten Tag nach dem Erdbeben hatten wir sieben Todesfälle innerhalb einer Stunde zu beklagen. Einige waren wahrscheinlich auf Lungenembolien zurückzuführen, da unsere Patienten ihre Betten nicht verlassen konnten, um ihre Gliedmaßen zu bewegen, und leider hatten wir kein Heparin, um Gerinnseln vorzubeugen. Es war eine niederschmetternde Erfahrung, von einem sterbenden Patient zum nächsten zu laufen, ohne helfen zu können.
Weitere „Hilfe“ trifft ein
Nachdem die örtlichen Radiosender über unseren Bedarf an „Hilfe“ berichtet hatten, wurden wir davon geradezu überlaufen und mussten uns überlegen, wie unserer Bedarf genau aussah. Jeden Tag trafen Ärzte, Krankenpfleger und Missionare ein, mit unterschiedlichen Vorstellungen davon, was wirklich benötigt wurde. Nicht alle hatten die Geduld, uns zuzuhören. Diese Freiwilligen waren zeitweise unentbehrlich, z. B. die Krankenpfleger aus Florida, die rund um die Uhr auf der Wundstation arbeiteten, oder Stephanie, eine belgische Internistin. Sie wohnte in derselben Straße, half mir bei der Leitung der Notaufnahme und hatte dabei immer ein kreolisches Wort des Trostes für die Patienten übrig. Daneben gab es aber auch weniger behilfliche Freiwillige, deren „Hilfe“ wir ablehnen mussten: einen rauchenden Franzosen beispielsweise, der unsere Patienten mit verfaulten Äpfeln versorgen wollte, oder eine aggressive Freiwilligengruppe mit fragwürdigen Vorstellungen in Bezug auf Einverständniserklärungen.
Die haitianischen Ärzte und Krankenpfleger benötigten einige Tage, um dem chaotischen Zustrom an Helfern, Vorräten und Patienten Herr zu werden. So konnten wir uns erst am neunten Tag mit der Aufgabenverteilung beschäftigen.
Kooperation
Das größte Hindernis beschrieb ein Orthopäde vom Saint Marc Hospital: Dort war man der Ansicht, dass wir bei Amputationen zu vorschnell vorgingen, während dort erst dann amputiert wurde, wenn die Extremität schon schwarz geworden war – trotz der Gefahr, den Patienten aufgrund einer tödlichen Infektion zu verlieren. Das liegt daran, dass man auch dort die Meinung vertrat, die Aussicht auf ein Leben ohne Extremitäten in Haiti eine düstere Aussicht war. Wir mussten viel übereinander lernen, bevor wir wie heute zusammen arbeiten und gemeinsam lächeln konnten.
Im Moment, am zwölften Tag nach unserer Ankunft und am fünfzehnten Tag nach dem Erdbeben, befinden wir uns in einer Übergangsphase. Trotz der täglich steigenden Opferzahlen (zurzeit über 115.000), der vielen Obdachlosen in den Camps in Port au Prince und des Mangels an Nahrung, Wasser, Benzin und Geld verbessert sich die Lage langsam. Allein am Saint Marc Hospital haben wir mittlerweile über 120 Operationen durchgeführt, und viele Patienten werden nun nach Hause entlassen. Erdbebenopfer werden kaum noch eingeliefert, und ein neues Team aus Kanada steht zur Ablösung bereit. Ich nehme mir einen Morgen frei, um in Ruhe duschen, nachdenken und schlafen zu können. Die einheimischen Ärzte und Krankenpfleger haben diese Woche ihre Arbeit wieder aufgenommen, nachdem sie Zeit für die Trauer um Verwandte und Freunde brauchten. Die Gespräche drehen sich um Nachbehandlungen von Amputationen, Hauttransplantationen, gespendete Prothesen, Physiotherapie und emotionalen Beistand. Die Krankenpfleger lernen, wie sie Patienten umdrehen und sie von ihren Betten auf Stühle bewegen, immer mehr Patienten benutzen Gehhilfen, und die Behandlung chronischer Erkrankungen hat wieder begonnen. Wir bekommen nun die Nachwirkungen dieser Katastrophe zu spüren … und es liegt noch ein langer Weg vor uns.
Das Leben geht weiter
Wenn ich über unsere Erfahrungen nachdenke, bin ich am meisten von der Leidenschaft unserer haitianischen und amerikanischen Freiwilligen beeindruckt – und von der Leidensfähigkeit der Haitianer. Trotz der Tatsache, dass sie in tiefer Armut leben und eine Tragödie nach der anderen verkraften mussten, sind die Menschen an diesem Morgen in der Lage, zu lächeln, in den Straßen zu musizieren und die Chorproben in der Kirche wiederaufzunehmen. Das Leben geht weiter …
Sachita Shah, MD, arbeitet als Notärztin in Providence, Rhode Island, USA.